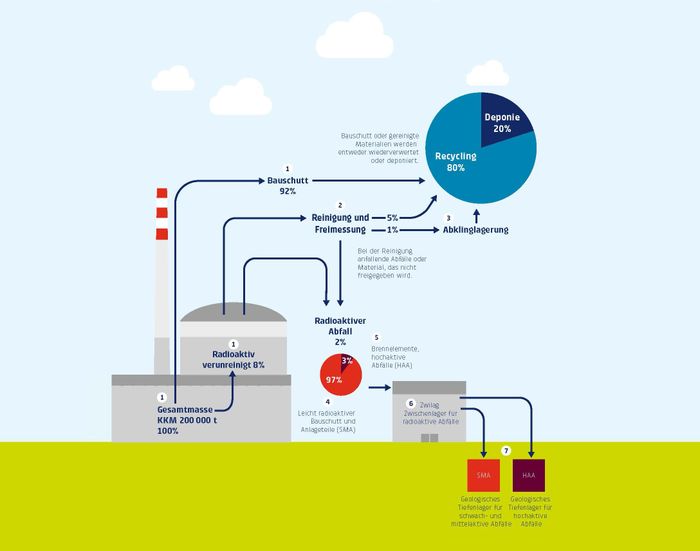Bohrungen Jura Ost:
Durch die bereits aus früheren Bohrungen in Riniken vorliegenden Daten, boten die erneuten Bohrungen Bötzberg 1 und Bötzberg 2 im Laufe des Jahres 2020, einen ergänzenden Überblick der geologischen Lage.
Bohrungen Nördlich Lägern:
Die Bohrungen in der Region Nördlich Lägern fanden in Bülach, Bachs, Stadel 2 und Stadel 3 statt, wobei der Opalinuston in Bülach mit etwa 900 Metern unter der Erdoberfläche am tiefsten liegt. Insbesondere interessant hierbei ist, dass die Untersuchungen gezeigt haben, dass ein Bau eines Tiefenlagers in dieser Tiefe deutlich besser geeignet ist als zuvor angenommen. In der Auswertung der im Vorfeld durchgeführten 2D-seismischen-Messungen wurde festgestellt, dass der Opalinuston im östlichen Teil der Region Nördlich Lägern unterhalb eines alten Korallenriffs ruhig liegt. Beruhigend: Das Korallenriff ist stark tonhaltig und ebenfalls dicht.
Bohrungen Zürich Nordost:
Die geologischen Schichten fallen in diesem Standortgebiet (ZNO) gegen Südosten hin ab. Gebohrt wurde in Trüllikon 1, Marthalen und einer Spezialbohrung in Rheinau. In diesem Gebiet war es möglich, senkrecht verlaufende Störungen im tiefen Untergrund zu untersuchen.
Fazit:
Die drei Regionen Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost verfügen alle über eine mehr als hundert Meter dicke, sehr dichte und ruhig liegende Opalinuston Schicht. Die Unterschiede zeigen sich in der Tiefenlage sowie in den umliegenden Gesteinsschichten rund um den Opalinuston – Sprich in den Rahmengesteinen.
Gemessen an den vier wichtigsten Kriteriengruppen – Eigenschaft der Gesteinsart (Opalinuston is a must), Langzeitstabilität (ruhige Lage über Millionen Jahre hinweg), Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen (Qualität der gesammelten Daten) sowie der Machbarkeit im betroffenen Untergrund ein Tiefenlager zu bauen – lässt sich eindeutig sagen, dass alle drei Regionen diese erfüllen. Da die oberste Maxime die Sicherheit ist, sind es nun die feinen Unterschiede der Regionen, welche satzbestimmend sein werden für die Standortbekanntgabe im September 2022 durch die Nagra.