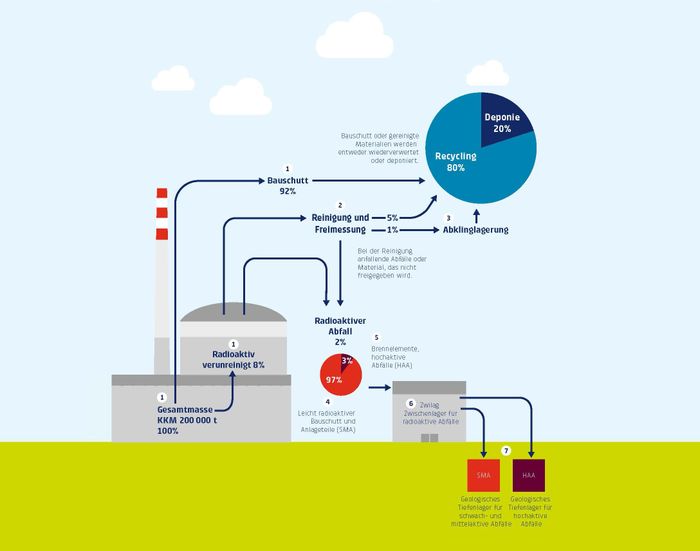Aus geologischen Tiefenlagern muss vor dem definitiven Verschluss die Rückholung gewährleistet sein. Das Konzept dafür wird in jedem Bewilligungsschritt weiter verfeinert, wie auch in jedem weiteren Schritt der Sicherheitsnachweis erneut erbracht werden muss. Was mit den zurückgeholten radioaktiven Stoffen geschehen soll, ist bis heute seitens des Gesetzgebers offen. Auch die EKRA hat dazu keine Empfehlung abgegeben. Das soll künftigen Generationen überlassen werden.
Das Konzept der «Rückholbarkeit ohne grossen Aufwand» ist im Kernenergiegesetzt verankert. Selbstredend vorausgesetzt, dass die Langzeitsicherheit des Tiefenlagers dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Gründe für eine Rückholung können mit dem technischen Versagen eines oder mehreren Lagerbehälter zusammenhängen. In diesem Fall würde man mutmasslich nur diese herausholen und den Inhalt sichern. Eine umfassendere Rückholung ist aus wirtschaftlichen Gründen denkbar, wenn es die Entwicklung der Kerntechnik erlauben würde, aus abgebrannten Brennelementen in einem Reaktor die noch vorhandene Energie zu nutzen.
Aus ethischen Gründen haben EKRA und Gesetzgeber dazu keine weiteren Empfehlungen bzw. Vorschriften erlassen. Die heutigen Regelungen übernehmen die Verantwortung für die sichere Lagerung im tiefen Untergrund, um die Gefährdung von Mensch und Umwelt nach bestem Wissen und Gewissen auszuschliessen. Die Option der Rückholbarkeit hält den Anordnungsspielraum und die Entscheidungsfreiheit der künftigen Generationen offen.
Fazit
Die Demut gegenüber künftigen Entwicklungen gebietet, die Antwort auf Fragen, die sich in 100 Jahren oder noch später ergeben könnten und die heute durchaus vorstellbar sind, den dannzumal in der Verantwortung stehenden Generationen zu überlassen. Der entscheidende Schritt dazu wurde mit der Festschreibung der Rückholbarkeit gemacht.